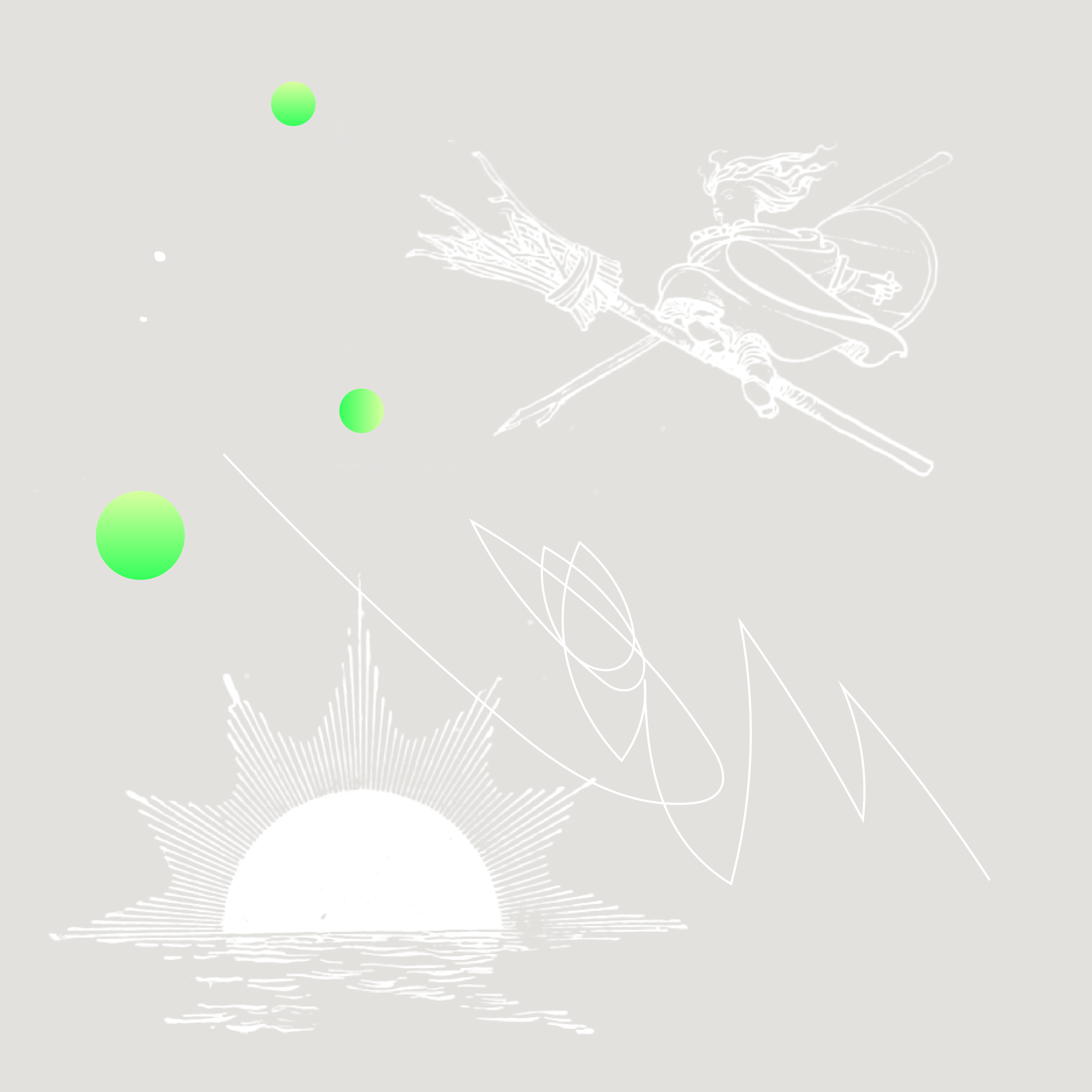
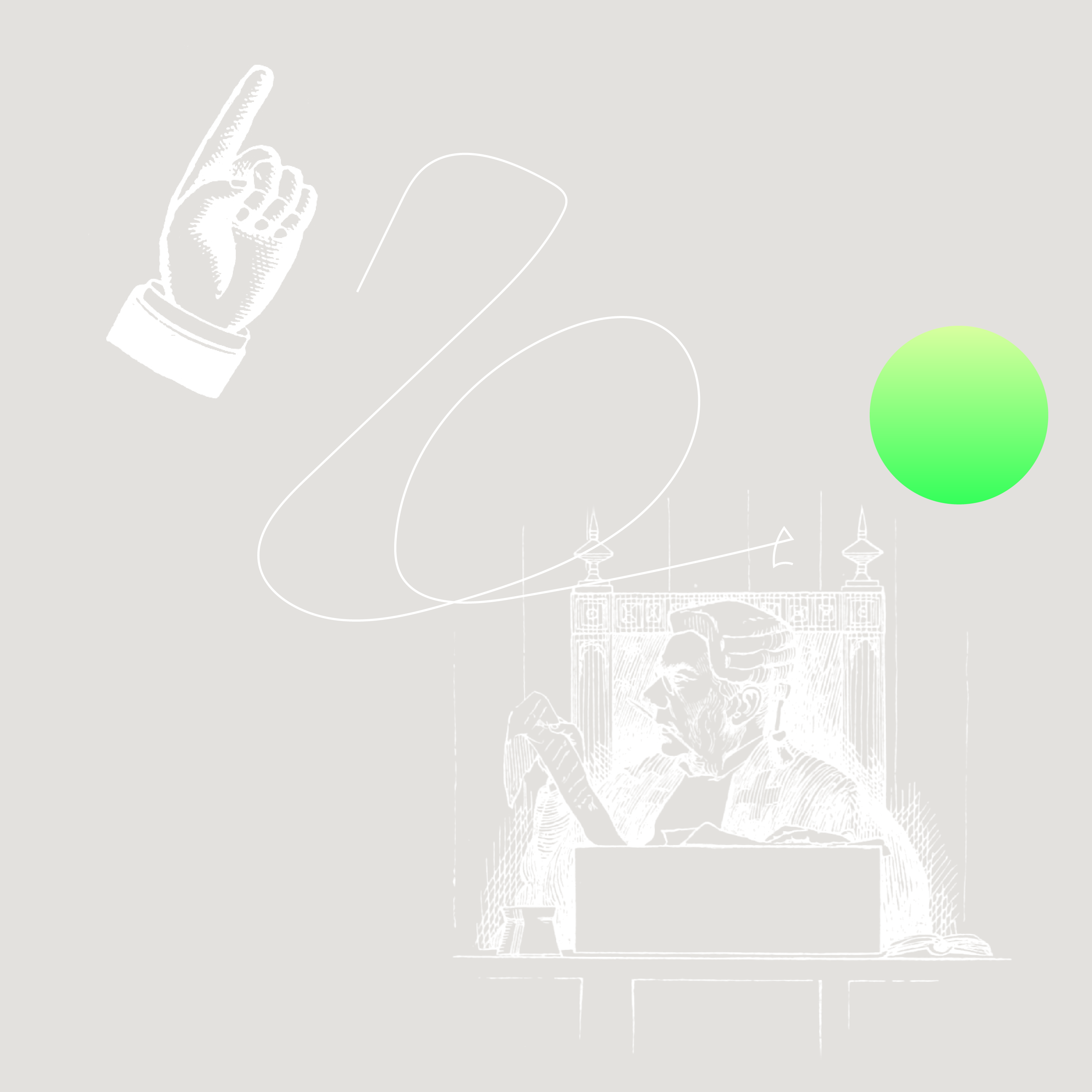
Kreativität und KI – ein Gespräch zwischen Kunst und Künstlichkeit
Kreativität und KI – ein Gespräch zwischen Kunst und Künstlichkeit
Leipzig, Berlin, München. Zusammen mit der Designerin Amelie Goldfuß und dem Maler Roman Lipski machen wir uns auf die Suche nach Digitalität in der Kunst – als Werkzeug und als Muse.
Hat sich euer Kunst- oder Kreativitätsverständnis durch die Existenz und Einbeziehung Künstlicher Intelligenz (KI) verändert?
Amelie Goldfuß (AG): Ich glaube nicht, dass sich dieses Verständnis durch KI verändert hat – weil es in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und Gesellschaft ja immer auch um solche Technologien geht. Mir liegt daran, diesen sehr „catchy“ Begriff der „Künstlichen Intelligenz“, der in den 50er -Jahren erfunden wurde, um Fördergelder zu bekommen, zu entmystifizieren. Ich spreche lieber von „KI-Anwendungen“, weil es in den verschiedenen Teilbereichen präziser wird: Wir reden dann zum Beispiel über „Natural Language Processing“, „Machine Learning“, auch über Teile von „Robotik“.
Roman Lipski (RL): Mein Verständnis hat sich verändert: Ich habe einiges umdenken müssen, nachdem ich die KI für mich entdeckt und praktisch eingesetzt habe. Denn für mich ist Kunst eine Art Lebenseinstellung.
Kann jeder Mensch kreativ sein?
RL: Ja, klar. Aber ich kenne sehr viele Künstler*innen, die absolut nicht kreativ sind – weil sie nur das produzieren, was sich am Anfang ihrer Karriere gut verkaufen ließ. Wenn du aber permanent liefern musst, was die Gesellschaft von dir erwartet, dann bist du verloren. Weil du als Mensch wie eine Maschine handeln musst, und da verlierst du deine Kreativität.
Die Kreativität gilt als Mittel des Menschen, sich selbst auszudrücken. Was war der Auslöser dafür, eure Kreativität mit Technik zu verbinden?
AG: Bei meiner Ausbildung zur Industriedesignerin an einer Kunsthochschule ging es ja ganz traditionell darum, sich mit Technik unter gestalterischen Aspekten auseinanderzusetzen: wie sie in der Gesellschaft, im Alltag vorkommt. Design sehe ich als eine Art Wissenskultur. Die Arbeit von Gestalter*innen passiert sehr „hands-on“ und im Dialog mit Technologie, Geräten.
RL: Ähnlich wie Amelie sehe ich die Affinität zu Technologie als einen wichtigen Initiationsmoment. Ich habe immer mit Pinsel und Leinwand gemalt. Aber ich will mich auch weiterentwickeln. Mein Stil war sehr narrativ, Landschaften, Architektur – und mit dem Gefühl, ich kopiere mich selbst, kam die Krise. Aber auch eine Lösung: Mein Ziel war das Abstrakte. Doch die Versuche aus eigener Kraft scheiterten. Die „KI-Muse“ war ein Experiment, das ich mit Florian Dohmann gewagt habe. Wir trainierten die Maschine zunächst mit all meinen Bildern, aber die Ergebnisse begeisterten mich nicht. Dann begann ich, extra dafür Bilder zu malen, in der multiplen Methode von Andy Warhol, also einem Prozess in einzelnen Sequenzen: sechzig Mal ein und dieselbe einfache Landschaft, gegenständlich und monochrom. Zufällig war das die perfekte Methode, um Dateien für einen Algorithmus zu sammeln. Damit haben wir ihn trainiert, und ein paar Wochen später hatten wir Tausende Variationen von Farben, Formen … es war gigantisch! Die Bilder waren abstrakt und gleichzeitig kohärent – und ich habe mich in ihnen wiedererkannt. Das war ein absoluter Wendepunkt. Zwar hatten die Bilder eine so kleine Auflösung, dass ich sie nicht als autonome Kunstwerke betrachten konnte. Aber sie hatten das Potenzial, mich zu inspirieren. Deswegen haben wir unsere KI eine „inspirative KI“ genannt – eine „Muse“.
AG: Diesen Vorteil der „Machine Learning“-Algorithmen, immer mehr vom Gleichen zu produzieren, finde ich interessant. Der Reiz liegt darin, dass es irgendwie trotzdem neu ist. Damit habe ich mich auch zusammen mit meinem Kollektiv beschäftigt. Wir sind auf ein sehr interessantes Datenset gestoßen: etwa 6.000 Bilder von Protestplakaten bei einem großen Women’s March in Boston 2017. Diese Plakate haben ein paar Professorinnen damals eingesammelt, digitalisiert, verschlagwortet und per Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Das Narrativ, dass sich Künstliche Intelligenz verselbstständigt – dass es auf einmal ganz allein Texte schreiben kann oder dass zwei KIs Geheimsprachen entwickeln, miteinander reden, und Menschen können gar nichts mehr verstehen –, ist ein ziemlicher, aber verbreiteter Medienhype. Wir versuchen, uns kritisch mit dem Mythos von der autonomen KI auseinanderzusetzen, deshalb haben wir gesagt: „KI, wir gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren!“ Wir haben aus dem Datensatz neue Protestplakate erzeugt, die zwar echt aussahen, die teilweise Symbole, auch Schrift reproduziert haben, aber im Endeffekt natürlich keinen Sinn. Denn es funktioniert ja über Pixelanalyse, nicht darüber, dass Buchstaben gelesen werden und Inhalt repliziert oder neu generiert wird. Es war also eine Auseinandersetzung mit Technik und gleichzeitig der Versuch, in den Diskurs zu treten: Was kann KI, was erwarten wir davon, was sind reale Risiken? Im nächsten Schritt haben wir gemerkt, dass es auch total interessant ist, daraus eine Vision für Künstliche Intelligenz zu entwickeln, die im Sinne von sozialen Bewegungen steht und nicht – wie es jetzt oft passiert – im Sinne von großen Konzernen agiert.
RL: Das wäre ein interessanter Ansatz: im Verbund mit Unternehmen, mit der Wirtschaft konzeptuell zu arbeiten, dabei aber grundsätzlich eine künstlerische Einstellung zu haben. Wir stellen die Fragen, provozieren, wir bieten keine Antworten. Aber alles dient einem Zweck: der Verbesserung der Gesellschaft, das Ziel ist etwas Positives. Es klingt paradox, aber mithilfe von Technologie könnten wir Prozesse humanisieren, Abläufe so gestalten, dass sie dem Menschen angenehmer sind.
„Ist noch der Künstler kreativ oder nur die Maschine?“ Wenn das Ziel von KI ist, den Menschen zu unterstützen und dadurch auch Raum zu schaffen für das eigentlich Schöpferische, ist diese Frage also Unsinn.
RL: Ja, vor allem geht es darum, den Menschen zu unterstützen. In dem Moment, in dem die Leute auf meine KI-Muse aufmerksam wurden, bekam ich Einladungen zu verschiedenen Talks und Präsentationen. Diese Einladungen kamen aus der Wirtschaft, die Kunstwelt hat das erst einmal verteufelt. „Wer ist jetzt der Meister: Du, oder entscheidet die KI, was du machst?“ „Eigentlich sind die KI-Bilder besser als deine!“ Alles klar.
AG: Aber im Endeffekt sind es ja deine Bilder! Es ist eigentlich nur ein schlauer Kniff von dir, genau das zu umschiffen, was du vorhin kritisiert hast: dass man immer das Gleiche malen muss, damit man „im Business“ bleibt. Weil durch deinen Prozess ja immer etwas Neues mit hineinkommt. Du hast einen guten Nutzen gefunden, durch diese „Technik“ deine eigene Arbeit noch mal ein Stück weiterzudenken. Das finde ich interessant!
RL: Danke dir – ja, wirklich: Ich bin nur der Maler, der die Algorithmen für sich entdeckt hat. Und ich bleibe ein Maler, egal, was ich dafür benutze!
Dein Konzept „Unfinished“ ist ein gemeinsames Malen unter Nutzung deiner „Muse“. Gibt es Berührungsängste unter deinen Gästen?
RL: Mit „Unfinished“ setze ich KI dafür ein, Leuten aus verschiedensten Disziplinen etwas Kreatives beizubringen. Durch diesen einfachen, praktischen Einsatz von KI und das klassische, händische Produzieren eines Objekts wird den Beteiligten sehr schnell klar, was einerseits KI, aber andererseits auch die eigene Kreativität, kann. KI kann unheimlich viel dazu beitragen, dass sich das kreative Potenzial bei den Leuten manifestiert, die behaupten, es nicht zu haben. Dieser soziale Mehrwert begeistert mich sehr! Es geht nicht um Abmalen. Die Künstliche Intelligenz gibt den Leuten Mut. Sie tauchen ein in den Dialog mit der KI und erkennen ihr Potenzial, weil die Muse ihnen Farben, Variationen, Wiederholungen zeigt.
AG: Aber auf welcher Grundlage erfasst denn die Kamera den Strich der Beteiligten?
RL: Die Netzwerke sind mit Aspekten meiner Bilder trainiert. Die Suggestionen kommen also aus meiner Ecke, aber dann entscheiden die Leute für sich und malen auf eine eigene Art und Weise. Das ist so spannend, ich lerne sehr viel dabei. Mittlerweile nutze ich die Muse nur noch sehr selten für meine eigene Arbeit. Aber ich erkenne, wie wertvoll die Kommunikation und Kooperation mit anderen Menschen für die Kreativität ist. Jetzt sind sie meine Muse. [lacht].
Amelie, hast du auch eine Muse, was treibt dich an?
AG: Ich glaube, ein intrinsisches Interesse an den Beziehungen zwischen Menschen und Technologien: Auch ein Pinsel oder ein Rührlöffel ist ja Technologie, also alles, was die Schnittstelle zwischen materieller Umwelt und Menschen ist, alles, was wir irgendwann mal gebaut haben, um zu interagieren. Wie sieht dieses Zusammenleben aus, wie funktioniert es? Und wie wirkt sich das, was wir gestalten und als Werkzeuge bauen, im Umkehrschluss wieder auf unser Leben aus? Das ist so interessant, ich glaube, da kann man schwer zu einem Ende kommen. [lacht].
Welche Fragestellungen, Hoffnungen, auch Bedenken begegnen dir in deiner Funktion als Dozentin?
AG: Das kommt immer auf den Kontext an. Ich bin oft an der Kunsthochschule – da sind natürlich ganz viele schlaue, fitte, interessierte Studierende, die haben vor allem Lust, etwas auszuprobieren. Auf den ersten Blick sieht Programmieren immer so schwierig aus – und dieser Gedanke ist tatsächlich auch die größte Hürde. Natürlich muss man sich reinfuchsen und braucht auch eine gewisse Ausdauer, aber es ist kein Hexenwerk, man kann es einfach lernen. Kürzlich habe ich mit Kids im Alter zwischen elf und fünfzehn gearbeitet, die haben innerhalb einer Stunde Chatbots programmiert. Da geht dann sehr schnell sehr viel und es entfaltet sich sehr viel kreatives Potenzial. Im Endeffekt geht es nur um Werkzeuge. Wenn man die richtig aufschließt, dann können sie auch alle sehr kompetent nutzen. Und das ist ja am Ende auch das Ziel: ein kompetenter, selbstbewusster, schöpferischer, aber natürlich auch ein kritischer Umgang.
RL: Das ist eine sehr schöne Aussage: Die Systeme sind nur tolle Werkzeuge. Und wenn man die beherrscht, dann öffnet sich eine riesige Palette an Möglichkeiten. KI kann einen sogar richtig glücklich machen! Durch KI habe ich keine kreativen Krisen mehr. Wenn ich irgendwie stehenbleibe oder Antworten suche, dann schalte ich meine Muse an.
Diese Werkzeuge haben also nicht zum Ziel, Kreativität zu ersetzen?
RL: Ich bin ein Befürworter der Nutzung von KI, aber da sehe ich bei vielen Studierenden, die ich unterrichte, eine Gefahr. Denn die Systeme sind einfach überwältigend und schnell und liefern so viel interessantes, attraktives Output. Das kann für jemanden, der neu auf der Suche und noch unentschlossen ist, dazu führen, in dieser Welt hängen zu bleiben, ohne eigenes kreatives Potenzial zu entwickeln.
AG: Ich stimme dir da meistens zu, würde aber doch ein bisschen einhaken und sagen: Ich finde es schon o. k., da am Anfang planlos reinzugehen und sich erst mal nur dafür zu interessieren, wie es funktioniert. Natürlich besteht dann die Gefahr, einfach nur noch Knöpfchen zu drücken. Ich denke aber, dass dieses relativ naive Einfach-Ausprobieren auch ein Weg sein kann, eine eigene Arbeitsweise zu finden und eigene Fragestellungen zu formulieren.
RL: Das glaube ich auch. Naivität ist unglaublich wichtig für Kreativität. Weil sie bedeutet, sich keine Grenzen zu setzen, offen zu sein. Am schönsten ist es, bei den Anfängen Unterstützung zu haben, und zwar durch einen Menschen, nicht nur eine Maschine. Das ist die beste Konstellation.
Was ist mit der Gefahr, irgendwann die Technik mit dem realen Leben zu verwechseln?
AG: Was heißt „verwechseln“ [lacht]? Sie gehört ja irgendwie mit dazu! Und auch dort spielen sich ja Leben und soziale Beziehungen ab, deswegen wäre ich da gar nicht so dogmatisch. Kompetenz und Kritikfähigkeit zu entwickeln, heißt auch nicht, dass am Ende alle professionell programmieren oder mit KI arbeiten müssen. Zum Beispiel Roman – du bist auch kein Programmierer, hast aber eine coole Kooperation, in der sehr viel Potenzial liegt. Natürlich hast du eine gewisse Kompetenz für Technologie ausgebildet, aber ohne dafür die „Hard Skills“ zu brauchen.
RL: Absolut. Wenn Leute aus verschiedenen Disziplinen mit einem gemeinsamen Ziel oder ähnlichen Zielen aufeinandertreffen, dann entwickeln sich unglaubliche Geschichten, darin steckt ein Riesenpotenzial. Solche Kooperationen einzugehen, ist sehr human, von dieser Art von Zusammenarbeit habe ich so viel mehr profitiert!
KI verändert die Gesellschaft, die Zukunft ist schon unter uns – so schlimm ist das also gar nicht, im Gegenteil.
RL: Ja, wir haben ein Zeichen der Zeit erkannt, wir nutzen es und bauen auch Brücken, damit nicht irgendwelche Eliten entstehen und der Rest nicht folgen kann. Deswegen finde ich es total schön, dass die Arbeit von Amelies Kollektiv eine starke soziale Komponente hat. Das ist auch mein Ansatz: Ich will ganz normale Leute mit der KI vertraut machen, um ihnen die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen, damit sie den Anschluss nicht verlieren. Das ist mein Traum – und das höchste Ziel meiner KI-Kunst.
AG: Das ist ein guter Punkt. Es wird immer gesagt: KI ist die Zukunft. Aber nur, weil das mal irgendjemand festgelegt hat, muss es nicht so sein. Vielleicht ist die Zukunft ja auch, dass wir alle mehr gärtnern! Irgendwie hält sich seit den 60er -Jahren das Zukunftsverständnis, dass alles Sci-Fi und „shiny“ und automatisiert sein wird, aber … warum eigentlich?

Foto: privat
Amelie Goldfuß
lebt und arbeitet als Designerin in Leipzig. Ihre Arbeiten sind im Spannungsfeld von Technologie und Gesellschaft angesiedelt. Dafür nutzt sie unter anderem Spekulation, Performance, KI und Robotik. Neben zahlreichen Vorträgen und Workshops unterrichtet sie auch an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Sie ist Mitbegründerin des interdisziplinären „Moving Target Collective“, das sich mit Künstlicher Intelligenz unter den Aspekten Kunst, Design, Soziologie und Computerwissenschaft beschäftigt. Die virtuelle Protestmarsch-Installation, von der sie im Interview berichtet, ist zu sehen auf https://latent-riot.space. https://ameliegoldfuss.com. https://movingtargetcollective.org.

Foto: Hans-Georg Gaul
Roman Lipski
lebt und arbeitet als Maler in Berlin. Als er 2015 die Einladung erhielt, an der Universität der Künste Berlin zu unterrichten, lernte er den KI-Spezialisten und Künstler Florian Dohmann kennen und ließ sich dazu inspirieren, mithilfe neuer Methoden „das coolste Bild ever“ zu generieren. Aus dieser Idee entstand die „KI-Muse“. Im Projekt „Unfinished“ lässt er seit einiger Zeit auch interessierte Laien an dieser Entwicklung teilhaben: mit Leinwand, Pinsel, Farben und einer Kamera als „Auge der Muse“, die ihre Anwender*innen in Echtzeit zu neuen Formen und Farben inspiriert. https://romanlipski.com
Zitation
Grenzmann, T. 2021: Kreativität und KI – ein Gespräch zwischen Kunst und Künstlichkeit. Im Rahmen des Projektes Digitales Deutschland. Online verfügbar: https://digid.jff.de/magazin/kreativitaet/kreativitaet-ki/

